Als Alice Munro 2013 den Nobelpreis für Literatur bekam, wurde die Kanadierin damit als Verfasserin zahlreicher Kurzgeschichten ausgezeichnet, in denen sie auf so kunstvolle wie zurückgenommene Weise Ausschnitte aus den Leben gewöhnlicher Menschen schildert und so außergewöhnliche kleine Kunstwerke schafft. Aber es gibt auch ein größeres Werk aus ihrer Feder, nämlich den 1971 erschienene Roman „Lives of Girls and Women„.
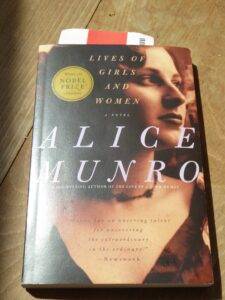
Inhalt des Romans ist das Leben bzw. das Aufwachsen von Del Jordan im ländlichen Ontario der 1940er und ja, der Roman hat biografische Bezüge, das gesteht auch die Autorin selbst zu, die allerdings einschränkt, das beträfe die Form, nicht die Fakten.
Und das ist zugleich der Punkt, in dem dieser Roman all den Kurzgeschichten ähnelt und doch ganz anders ist. Es geht um ein alltägliches Leben, das Heranwachsen eines Mädchens zur Frau in den 1940ern auf dem Land, also rein inhaltlich betrachtet um nichts außergewöhnliches oder gar überhöhtes. Doch anders als in vielen der Kurzgeschichten scheint zumindest mir die Ich-Erzählerin doppelt näher: Näher an mir, selbst wenn mein Aufwachsen Jahrzehnte später auf einem ganz anderen Kontinent stattfand, und näher an Del Jordan, der Figur. Was erstmal seltsam klingen mag, also muss ich ein bisschen ausholen.
Natürlich gibt es in vielen von Munros Kurzgeschichten Ich-Erzählerinnen und darunter sicher mehr als eine, die noch nicht erwachsen ist, als die erzählte Handlung stattfindet. Aber beim Lesen bleibe ich dennoch ein Stück auf Abstand, weil sich diese Ich-Erzählerinnen im Rückblick des Erzählens von sich selbst als Figur, als erlebender Ich-Heldin distanzieren oder die Brücke zurück ins damalige Nochnichtwissenkönnen nicht finden. Und das, obwohl Munro gern und oft im Präsenz erzählt.
„Lives of Girls and Women“ ist dagegen klassisch im Präteritum geschrieben, wenn es um die Erlebnisse der jungen Del geht. Und auch, wenn sich gelegentlich Del als Ich-Erzählerin im Präsens Fragen stellt etwa über den Verbleib dieses oder jenes Menschen im Lauf der Zeit, ändert das nichts daran: Das Buch ist die Geschichte der heranwachsenenden Del, sie steht im Mittelpunkt, und hinter ihr tritt die Erzählerin zurück.
Gerade bei einer Geschichte mit einer Pubertierenden im Zentrum ist das wohltuend. Jeder, der über dieses Stadium selbst hinaus ist, weiß doch, an wie vieles aus dieser Zeit man sich mit dem Grusel der Peinlichkeit erinnert – und das tendenziell um so mehr, um so ernster einem seinerzeit das war, was gerade (mit einem) passierte. Die Versuchung, das mit Komik zu kompensieren, also das frühere Selbst oder eben das erfundene, fiktionale Pubertier, lächerlich zu machen, scheint in vielen Büchern mehr, als deren Autor*innen verkraften. Und das gilt natürlich um so mehr, wenn diese Pubertät auch noch auf dem platten Land stattfindet … ich sag nur „komische Dorfromane“!
Wie wohltuend, dass Munros Ich-Erzählerin ihr früheres Selbst einfach so nimmt, wie sie ist, ihr sozusagen loyal zur Seite steht und die Dinge erzählt, wie Del sie damals erlebt. Denn genau das erlaubt es mir trotz zeitlichem wie räumlichen Abstand, die Geschichte nicht einfach zu lesen, sondern darin auch mich selbst wiederzuerkennen – und natürlich Munros große Erzählkunst.
