„Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ – es gibt Tage, da möchte ich verzweifelt Immanuel Kants Worte an jede Wand sprühen. Ob Omri Boehm ähnlich fühlte, als er sich aufmachte „Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität“ zu schreiben? Möglich wäre es. Das Folgende ist jedenfalls mein Versuch, meine Lesart seines klugen, zum eigenen Denken und auch zum Weiterlesen anstiftenden Buches (auf Deutsch erschienen 2023 bei Ullstein) nachzuzeichnen.
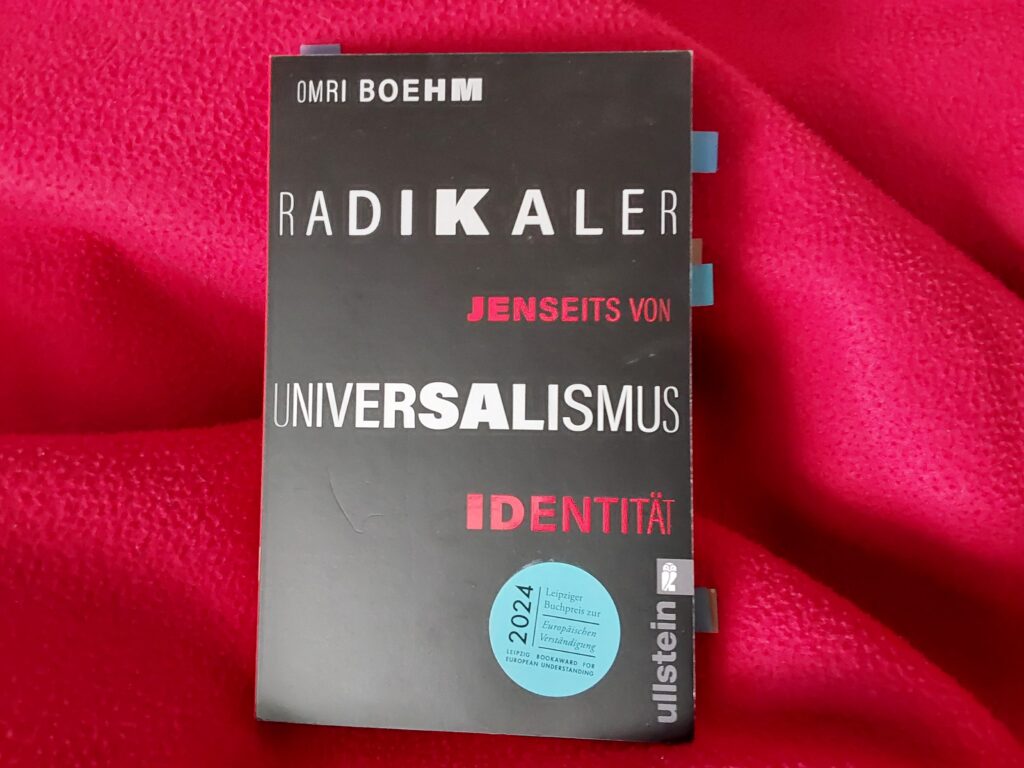
Ausgangspunkt der Überlegungen des Philosophen Omri Boehm ist die Feststellung, dass Identität als Ideologie inzwischen das gesamte politische Spektrum beherrscht – während die Linke im Namen von race und gender kämpft, kämpft die Rechte im Namen der Nation. Der moderne Liberalismus wendet sich nicht mehr an alle Menschen, sondern dient nur noch den Interessen der Bürger. Und der Universalismus ist unter die Räder bzw. zur reinen Hülle verkommen, heißt es sinngemäß im Klappentext.
„Es sollte offensichtlich sein, dass die Nation der falsche Ausgangspunkt ist, um den Universalismus zu verteidigen“, stellt Boehm im Prolog auf S. 16 fest, und schreibt weiter: „Ein Abgrund trennt die einzig mögliche Quelle universalistischer Politik – eine selbstverständliche Wahrheit über die Gleichheit aller Menschen – von der Reduktion dieser Wahrheit auf eine sehr gute Idee.“ Okay, wer wenig oder keine Erfahrung mit dem Lesen philosophischer Texte hat, mag bereits hier stutzen – aber die Bedeutung von Begriffen zu klären und diese klar von einander abzugrenzen, um sie hinterher nur um so präziser zueinander in Beziehung setzen zu können, ist nun mal die Basis, wenn es um Philosophie, also Weisheitsliebe und den Versuch, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen und zu verstehen geht.
Damit die Gleichheit aller Menschen eben nicht nur eine „gute Idee“ ist, sondern eine Wahrheit ist, muss, wie von Kant gefordert, der Begriff der Menschheit abstrakt bleiben, heißt es in Boehms Prolog: Vom Ursprung. „Bei Kant wurde die Idee der Menschheit erstmals moralisch formuliert: Was Menschen menschlich macht, ist keine natürliche Eigenschaft, sondern ihre Freiheit, ihrer Verpflichtung auf moralische Gesetze zu folgen. Weil menschliche Lebewesen offen für die Frage sind, was sie tun sollen, sind sie selbst Subjekte absoluter Würde.“ (S. 16 f) D.h. es geht nicht einfach nur darum, irgendwelche Gesetze zu befolgen, seien sie gut oder weniger gut, sinnvoll oder schlecht, sondern um die Erkenntnis einer (Selbst)Verpflichtung auf ein viel größeres, moralisches Gebot – und damit etwas fundamental Universelles. Boehm drückt das so aus: „Nur ein Gesetz oder eine Wahrheit, die unabhängig von menschlichen Konventionen ist, ist universell in seinem oder ihren Geltungsbereich und nicht relativ zu den Interessen.“ (S. 17)
In Kapitel 1 Das Kainsmal zeigt Boehm u.a., wie sich der Unabhängigkeitskrieg in den USA auch oder vor allem als Frage nach dem Universalismus, konkret: der Geltung der Menschenrechte für alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe – verstehen lässt. Die wandelnden Bedeutungen und unterschiedlichen Zuschreibungen, die der Universalismus im Lauf des Bürgerkrieges durchlief, setzt Boehm in Beziehung zu den biblischen Grundlagen (Kain, Abel, aber auch Hiob sowie, ganz zentral Isaak) und zu Kants Gedanken. Nach diesen „hängt [Würde] von Freiheit ab, die das Vermögen ist, nicht durch konkrete Tatsachen bestimmt zu sein. Sie kann deshalb nur abstrakt sein. Da sie abstrakt ist, ist ihr Geltungsbereich universell und schließt alle Menschen mit ein.“ (S. 52)
Und Universalismus bedeutet dann eben, sich im Kampf für die Gerechtigkeit mit allen moralisch gebotenen Mitteln für Gerechtigkeit für alle einzusetzen, und dabei auch unmoralische Konventionen und ungerechte Gesetze zu übertreten. Boehm führt hier Martin Luther King als Beispiel an, der sich 1963 zum gerichtlich verbotenen Protestmarsch gegen die Segregation in Birmingham aufrief und anschließend in Einzelhaft saß. Derweil verfasste eine Gruppe von Klerikern einen offenen Brief, in dem sie einerseits Verständnis für seine Ziele äußerten, ihn andererseits jedoch dafür kritisierten, dass er auf dem Weg dorthin bewusst und offen das Gesetz gebrochen hatte. Kings Antwort hätte kaum prägnanter und eindeutiger ausfallen können: „Wenn irgendwo Unrecht geschieht, ist überall die Gerechtigkeit in Gefahr.“ (Boehm, S. 64) Gerechtigkeit ist also ein universelles Gebot, könnte man folgern. Was ich für mich fordere, muss auch für alle anderen gelten.
Und hier trifft Omri Boehms Buch gewissermaßen auf mein Leben. Denn so bin ich aufgewachsen und erzogen worden: nämlich mit Kants kategorischem Imperativ als Richtschnur. Natürlich hat mein Vater mich als Vierjährige nicht ermahnt „handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“, obwohl er mir früh von dem Philosophen erzählte, der zwei Jahrhunderte zuvor im fernen Königsberg lebte. Aber die kindgerechte Variante des Imperativs in Form von „behandle andere stets so, wie du selbst behandelt werden willst“ („was du nichts willst, was man dir tu, das füg auch keinem andern zu“ ins Positive gewendet, denn mein Vater war ein sehr positiver Mensch, auch wenn er den Wert von Reimen kannte ;)) machte für mich unmittelbar Sinn. Dieser Imperativ ist logisch, nachvollziehbar und es ist auf den ersten Kinderblick klar, dass nach der Maxime alle gut mit sich selbst und miteinander leben können. Außerdem lässt sich das auf alle Lebenslagen anwenden. Erst später wurde mir an den Reaktionen anderer Menschen klar, dass mein Vater da wohl eine eher ungewöhnliche Herangehensweise gewählt hatte. Erwachsene meinten, das wäre doch sicher eine Überforderung für ein Kind (was mir nie so erschien) und Kinder waren erstaunt, weil sie Erziehung hauptsächlich in Form von mehr oder weniger systematisch verteilten Belohnungen und Strafen kannten (die mir idiotisch vorkamen). Für mich war der Aufruf, in dem mir jeweils möglichen Maß über die Konsequenzen meines Handelns nachzudenken, bevor ich etwas tue, und mich dabei wenigstens versuchsweise in andere Beteiligte hineinzuversetzen, eine gute Richtschnur. Wobei alle Aspekte – eigenständiges Denken, sich in den anderen hineinversetzen, gefolgt von der Bereitschaft, so Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen – zusammengehören, und, wenn ich so darüber nachdenke, auch eine ziemlich gute Grundlage für mein eigenes Kunst- und Literaturschaffen bilden.
Um Kunst und Literatur geht es bekanntlich auch immer wieder im Zusammenhang mit Identitätspolitik, die häufig die Idee vertritt, jede/r könnte nur im Kontext seiner/ihrer Identität Kunst schaffen und es sei nicht nur ‚unmöglich‘, den Standpunkt einer anderen ‚Identitätsgruppe‘ jemals zu verstehen und somit über ihn künstlerisch zu reflektieren, sondern dies sei geradezu unmoralisch und grundfalsch, ja womöglich zu verbieten, es auch nur zu versuchen. Der Gedanke, wir alle könnten (und sollten!) quasi nur noch unser eigenes Sein in unserer Kunst be- und verarbeiten, kommt mir absurd vor. Wozu sollte das gut sein? Gewiss, ich kann nicht behaupten, dass ich aus Erfahrung weiß, wie sich eine Person mit einer sichtbaren Behinderung in dieser Gesellschaft fühlt, aber das heißt doch nicht, dass ich nicht versuchen kann, mich in diese Situation hineinzuversetzen und mich zu fragen, wie wäre das für mich? Etwas ähnliches machen wir alle doch tagtäglich, wenn wir versuchen, unser jeweiliges Gegenüber hoffentlich nicht nur aus unserem eigenen ‚Außenblickwinkel‘ zu betrachten, sondern mitbedenken, dass jedes dieser Gegenüber mit einem eigenen Standpunkt, eigenen Gefühlen, Gedanken, Interessen und Wünschen ausgestattet ist, die mit unseren mal deckungsgleich, mal grundverschieden, doch stets gleichermaßen existenzberechtigt und valide sind. Und Kunst kann in meinen Augen ein verdammt guter Weg sein, Brücken zwischen unterschiedlichen, möglichen und vielleicht auch (noch) unmöglichen Erfahrungen zu bauen.
Boehm geht der Frage nach der ‚Cancel Culture‘ am Kunstwerk „Open Casket“ von Dana Schutz aus dem Jahr 2017 nach. Das Gemälde der weißen Künstlerin zeigt großformatig ge- und in ihrer charakteristischen Weise übermalt die Fotografie des offenen Sarges von Emmett Till, die der Chicago Defender 1955 abgedruckt hatte. Der vierzehnjährige, afroamerikanische Jungen war zuvor von einer Gruppe weiße Männer entführt, gefoltert und ermordet worden. Als dieses Gemälde auf der Biennale des Whitney Museums of American Art gezeigt wurde, entbrannte ein heftiger Streit darum, weil, so berichtet es Boehm, es sich hier eine weiße Künstlerin erlaubt, über schwarzes Leid zu arbeiten (wer alle Details seiner Überlegungen nachlesen möchte, kann dies auf S. 100 ff in seinem Buch tun). Das Hauptargument, das dabei gegen Schutz verwendet wurde, war, dass sie schwarzes Leid als Rohmaterial nutze, was als eine Form der Aneignung angesehen wurde (ein Begriff, bei dem ich jedes Mal stolpere, denn ich würde mich dann stets eine Abgrenzung von zulässiger und unzulässiger Aneignung wünschen). Bei der erwähnten Biennale jedenfalls blieb das Bild mit einer Erklärung von Schutz, dass sie natürlich nicht wissen könne, wie es ist, in Amerika schwarz zu sein, sie dieses Bild jedoch aus ihrem Blickwinkel als Mutter gemalt hätte, in der Ausstellung hängen. Immerhin war es ja Emmetts Mutter, die den vermutlich nicht allgemein üblichen Entschluss gefasst hatte, ihren ermordeten und verstümmelten Sohn in einem offenen Sarg beerdigen zu lassen.
Auf den ersten Blick ist Schutz‘ Erklärung nachvollziehbar – das Kunstwerk wird gewissermaßen zum verlängerten Teil ihrer eigenen Identität, dockt halt bloß an einer anderen Stelle an, als die Protestierenden forderten. Damit benutzt auch sie Identität als Legitimation und hätte, wie Boehm meint, mit gleicher Berechtigung die Petition gegen die Ausstellung ihres Bildes unterzeichnen können. Vor allem aber, so Boehm, geht hierbei die wichtige Erkenntnis verloren, „dass weder die schwarze noch die weibliche, noch die jüdische Erfahrung in irgendjemandes Besitz sein kann.“ (S. 106). Und weiter heißt es hier: „Diejenigen, die sich habituell über ‚Aneignung‘ beschweren, offenbaren damit nur ihre Annahme, dass menschliches Leid von seinen rechtmäßigen Eigentümern als ‚Rohmaterial‘ verwendet werden darf. Das Problem besteht darin, dass alles, was von jemandem besessen werden kann, auch von jemand anderem besessen werden kann; das ist im Wesentlichen eine Frage des Preises.“ (S. 106f)
Mir scheint, wer bei dem Gedanken nicht stutzt, wem dabei nicht ein wenig anders wird, hat menschliches Leid nicht verstanden. Wie könnte menschlicher Schmerz Eigentum sein? Wie kann man eine Erfahrung besitzen? Als Gewaltüberlebende würde ich eher sagen, wenn man Pech hat, wird man zeitweilig von Erfahrungen besessen … Boehm dagegen stellt fest: „Allerdings impliziert die Tatsache, dass kein menschlicher Schmerz jemandes Eigentum sein kann, nicht, dass er nicht Gegenstand der Kunst sein kann. Im Gegenteil, er muss in künstlerischem Schaffen verarbeitet werden, in diesem einzigartigen Medium menschlichen Handelns, dem es möglich ist, die vorherrschende Reduktion des Denkens auf eine instrumentelle Verwendung zu überwinden.“ (S. 107)
Was für eine schöner Gedanke – damit würde die Freiheit der Kunst (also genauer die dem Kunstschaffen innewohnende Freiheit, die gleichzeitig dessen Voraussetzung ist) die Freiheit des Denkens befreien! Am liebsten würde ich sofort hingehen und das Bild malen oder mit Worten nachzeichnen, dass dieser Gedanke in meinem Kopf entstehen lässt: zwei majestätische Vögel, die gemeinschaftlich in die Wolken aufsteigen, und unten am Boden bleiben die Ketten oder der Käfig des einen zurück. Doch zurück zu Boehms Buch, dessen Überlegungen ein wenig weiter unten auf der bereits zitierten Seite zu dem Schluss kommen: „Wenn es so etwas wie Kunst gibt, dann ist sie nur möglich, weil Künstler nicht autoritär die Bedeutung ihrer Kunst festlegen.“ (S. 107)
Oder, wie ich es in meinen Literaturkursen und bei der Arbeit mit anderen, auch angehenden Literaturschaffenden formuliere: Vergiss nie, in dem Moment, wo du etwas veröffentlichst, gibst du die Deutungshoheit aus der Hand und dein Verständnis deines Werkes ist mit einem Schlag nur noch eine Interpretation unter zahllosen weiteren.
Doch die zentrale Frage bei Boehm betrifft ja nicht die Kunst, sondern die Aufklärung, ihre Wurzeln im Verständnis bestimmter biblischer Figuren (allen voran Abraham, der mit der Forderung Gottes konfrontiert wird, seinen Sohn Isaak zu opfern) und was all das für das Verständnis des Universalismus bedeutet. Entsprechend ist das dritte Kapitel mit „Die Abrahamitische Unterscheidung oder Was Aufklärung ist“ überschrieben. Dabei geht es u.a. um die Frage, was eigentlich genau welche Überlieferung von der Prüfung Abrahams erzählt, wenn er von Gott aufgefordert wird, seinen Sohn Isaak zu opfern, mit ihm auf den Berg geht, ein Opfer vorbereitet und mehr oder weniger im letzten Moment statt des Jungen einen Widder opfert. Boehm betrachtet die Geschichte dabei mit den Augen eines quellenkritischen Literaturwissenschaftlers – er sucht also nach Spuren im Text (in der Art der Erzählung, des Wortwahl, etc.), die sich unterschiedlichen Entstehungskontexten zuordnen lassen. Dadurch lässt sich am Ende belegen, dass in der ursprünglichen Version Abraham selbst derjenige ist, der entscheidet, seinen Sohn nicht zu opfern und den Widder wählt und der Engel, der eingreift und ihn abhält, zu einer späteren Version der Geschichte gehört. Boehm folgert: „Kants ‚kopernikanische Wende‘ in Sachen Autorität wurde in Wirklichkeit von Abraham verkörpert. Der Vater des Monotheismus verstand nur zu gut, dass Menschen die Lebewesen sind, die der Pflicht zur Gerechtigkeit folgen und aus diesem Grund kein Recht haben, zu gehorchen. […] Nichts kann Autorität über die Gerechtigkeit beanspruchen. Ein ungerechtes Gesetz ist kein Gesetz. Das Lebewesen, das fähig ist, diesem nichtmenschlichen Grundsatz zu folgen, ist menschlich und gebietet unseren absoluten Respekt.“ (145f)
Womit klar wäre, wie radikal Universalismus tatsächlich sein kann, wenn man ihn so versteht. Am Ende dieses Buches – genauer: meines bislang erstmal doppelten Weges mit diesem Buch, denn über es zu schreiben, hieß, es über weite Strecken erneut und zugleich ‚anders‘ zu lesen – möchte ich zum einen am liebsten mehr Philosophie lesen, sei es nach Ewigkeiten mal wieder Kant selbst oder Boehms Israel – eine Utopie oder etwas ganz anderes, und zum anderen, nun, zum anderen sind die Zeiten doch wirklich gerade danach, „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes“ an jede verfügbare Wand zu pinseln, oder etwa nicht?
